![]()
![]() Internet: Ein Medium der Zukunft
Internet: Ein Medium der Zukunft
![]() Gesellschftsplitische Bedeutung für Sehgeschädigte und neue Perspektiven
Gesellschftsplitische Bedeutung für Sehgeschädigte und neue Perspektiven
![]()
Zentrales Thema dieser Hausarbeit sind die Möglichkeiten, Chancen und Risiken, die sich für Sehgeschädigte mit dem Internet ergeben. Doch was ist eine Sehschädigung überhaupt? Wann ist jemand sehbehindert oder blind? Wie arbeiten eigentlich Sehbehinderte mit dem PC? Und wie unterscheidet sich dazu ein Blindenarbeitsplatz? Wie ist der Ausstattungsgrad mit PC-Arbeitsplätzen an Blinden- und Sehbehindertenschulen? In welchem Umfang werden sehgeschädigte Schüler mit dem PC vertraut gemacht (Informationstechnische Grundbildung)?
![]()
Die Gruppe der Sehbehinderten und Blinden ist sehr inhomogen. Dies zeigt sich z.B. in der Klasse einer Sehbehindertenschule, wenn ein Schüler ein Röhrengesichtsfeld besitzt und daher eine kleine Schrift am besten lesen kann, sein Nebensitzer jedoch unbedingt große Schrift benötigt, da seine Stelle des schärfsten Sehens ausgefallen ist (Makulaerkrankung). Diese kurzen Beispiele lassen erahnen, wie schwierig eine Kategorisierung des Begriffs der Sehbehinderung fällt.
Die einfachste und herkömmliche Art, den Personenkreis zu umgrenzen, ist die Angabe der Sehschärfe (des Visus). Jedoch erlaubt der Visus als Meßgröße der physiologischen Leistungsfähigkeit des Auges keine oder nur eine bedingt gültige Aussage darüber, wie die Sehschärfe im täglichen Leben genutzt werden kann.
Viele Blinden- und Sehbehindertenpädagogen haben daher zu der Problematik der Abgrenzung und Vielschichtigkeit des Begriffs Artikel veröffentlicht, so daß an dieser Stelle mit Verweis auf die jeweiligen Publikationen auf eine ausführlichere Beschreibung verzichtet wird. Mit der Einteilung von Funktionseinschränkungen nach Rath (1987) soll im Rahmen dieser Arbeit nur kurz eine mögliche Kategorisierung angegeben werden:
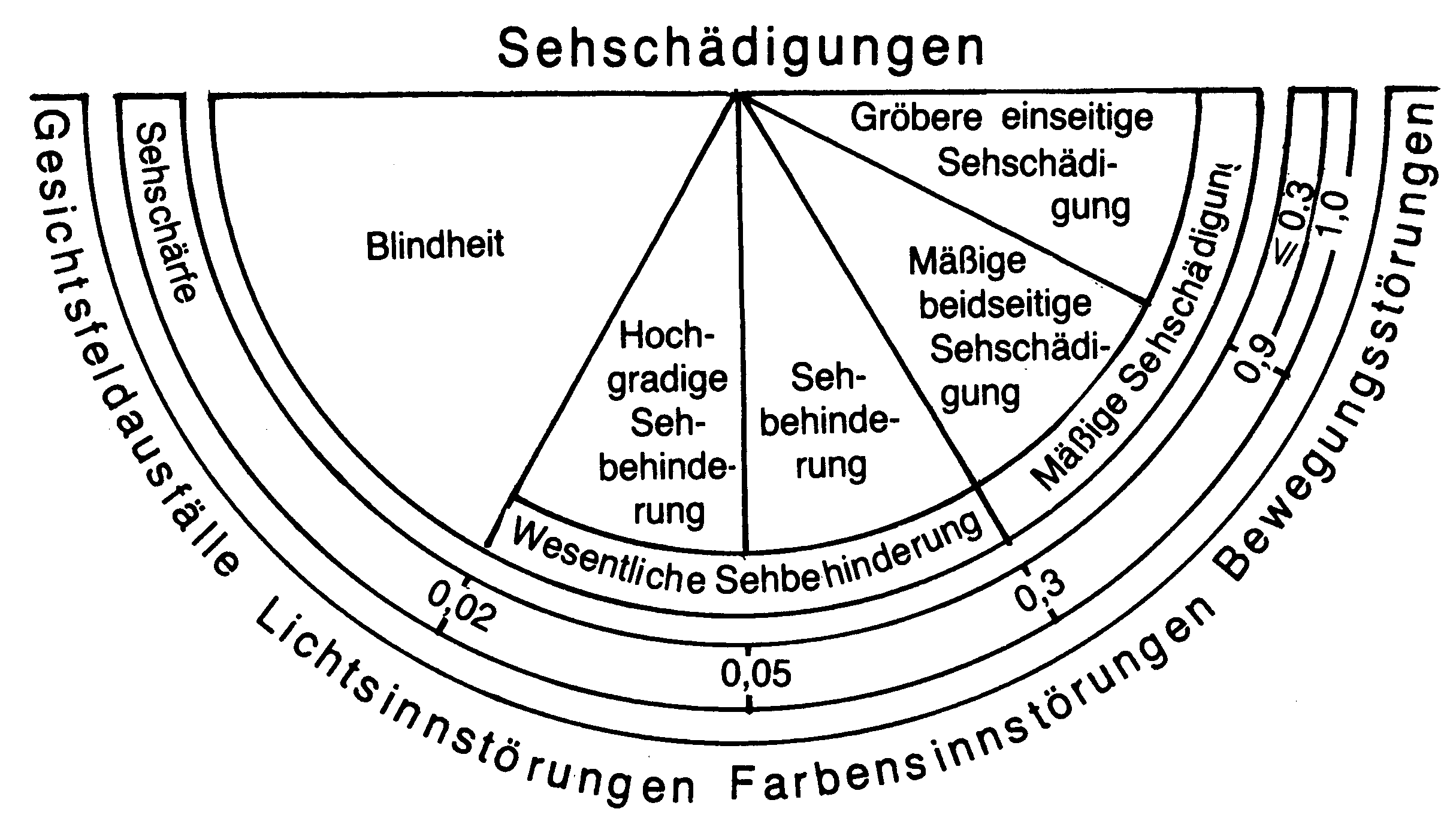
Dieses differenzierte Modell zur Klassifikation von Einbußen der Sehfunktion berücksichtigt neben der Sehschärfe auch andere Funktionen des Sehens wie z.B. Gesichtsfeldeinschränkungen oder Farbsinnstörungen. Es ergeben sich folgende fünf Gruppen:
Eine weitere differenzierte Betrachtung der Mehrdimensionalität von Sehschädigungen unter Berücksichtigung der drei Aspekte Visuelle Fähigkeiten, Visuelle Außenreize sowie Individuelle Voraussetzungen werden im Modell von Corn (1983) übersichtlich dargestellt, sollen hier jedoch nicht weiter erläutert werden.
Computerarbeitsplatz bei Sehbehinderten und BlindenEs gibt unterschiedliche Möglichkeiten, einen Computerarbeitsplatz für Sehbehinderte und Blinde den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend zu konfigurieren. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die prinzipiell realisierbaren Alternativen:
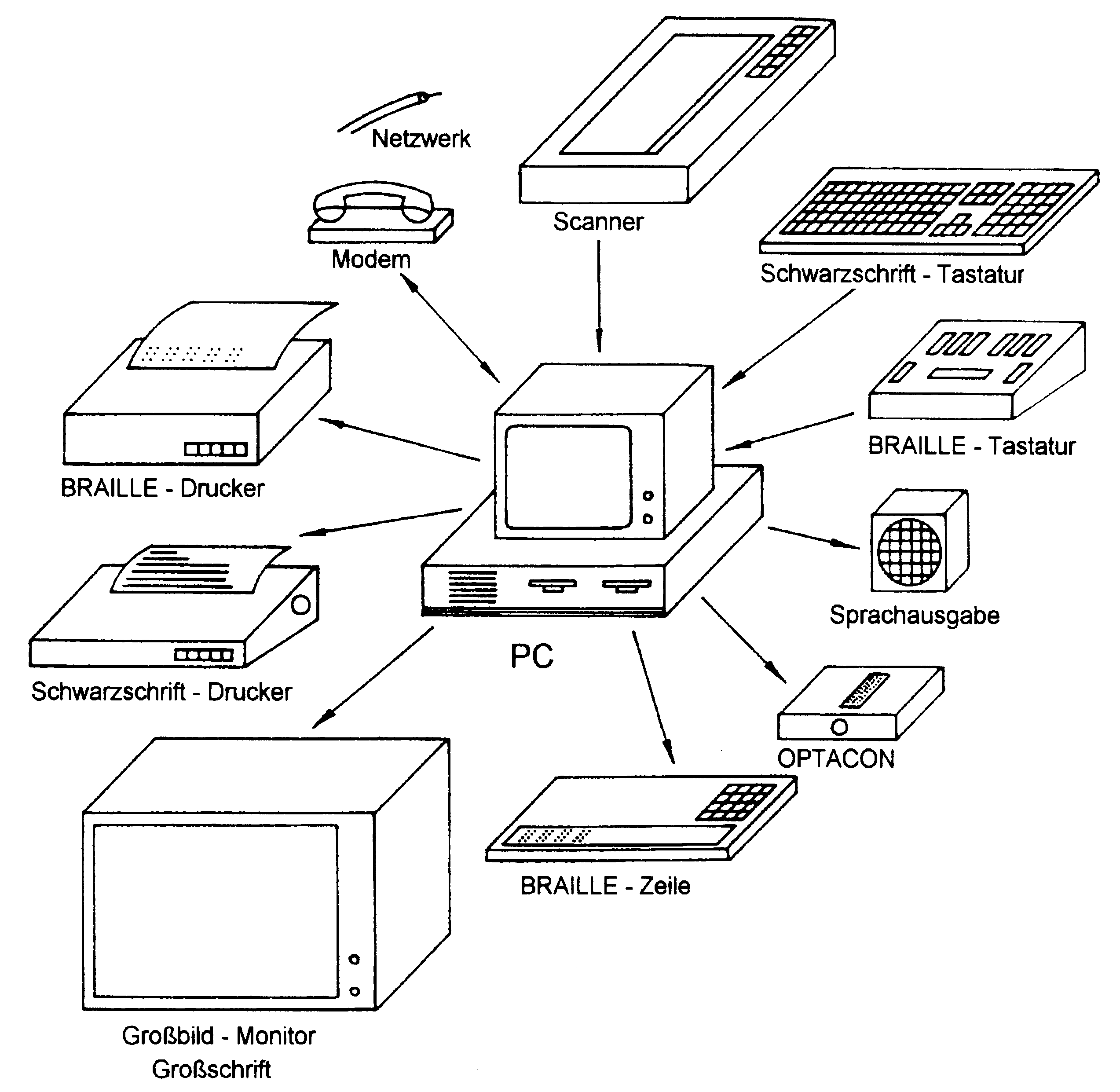
Diese Abbildung zeigt, wie umfassend die möglichen Anpassungen sein können. Dabei läßt sich die gesamte Peripherie in drei Gruppen unterscheiden:
Das Haupthindernis für Sehgeschädigte bei der Arbeit mit dem Computer liegt nicht so sehr in der Dateneingabe, da sie in der Regel die Schreibmaschinentastatur beherrschen. Das Hauptproblem besteht vielmehr darin, einen Zugriff auf diejenigen Informationen zu bekommen, die der PC über den Bildschirm an den Benutzer ausgibt. Die folgende Übersicht differenziert nach dem Grad der Sehschädigung die heute gebräuchlichen Ausgabegeräte für Blinde und Sehbehinderte:
|
Grad der Sehbehinderung |
blind |
hochgradig sehbehindert |
sehbehindert |
|
Ausgabegeräte |
Brailledrucker |
Schwarzschriftdrucker mit Großdruck |
|
|
Braillezeile |
Bild- oder Schriftvergrößerung |
großer Bildschirm |
|
|
Sprachausgabe |
|||
Die Braillezeile „ermöglicht ein direktes Auslesen einer Bildschirmzeile (bzw. eines Teiles davon) durch die Umsetzung der ASCII-Zeichen in 8-Punkt-Computer-Vollschrift-Braille (heute gängige Technik: Piezoprinzip). Eine Braillezeile besteht aus 40 oder 80 Modulen mit jeweils acht beweglichen Stiften in einer mit der Fingerkuppe ertastbaren 2´ 4-Matrix."
Ein Großbildschriftsystem stellt einen Teilausschnitt des Original-Bildschirminhalts in vergrößerter Form auf dem Bildschirm dar. Die synthetische Sprachausgabe liest den Text auf dem Bildschirm buchstaben-, wort- oder seitenweise aus. Der Brailledrucker stanzt Texte in Punktschrift auf Papier.
Allen aufgeführten Ausgabemedien ist folgende Problematik gemeinsam: der Sehgeschädigte kann durch sein Zusatzgerät jeweils immer nur einen Teilausschnitt von dem erfassen, was auf dem Bildschirm gleichzeitig dargestellt wird. Dies impliziert aber wiederum erneute Schwierigkeiten. So erhält der Sehgeschädigte von vornherein eine geringe Übersicht über den Bildschirm angeboten. Er muß also mehr Zeit investieren als der Sehende, was auch eine gewisse intellektuelle Leistung voraussetzt. Desweiteren erhält er die Informationen linear strukturiert angeboten im Gegensatz zum zweidimensionalen Bildschirm. Dieser Problematik kommt insbesondere auch bei der Arbeit im Internet eine große Bedeutung zu.
Zusätzlich muß der Sehgeschädigte mit dem Einsatz seiner Anpassung zusätzliche Steuerungsfunktionen der entsprechenden Soft- oder Hardware beherrschen. Dadurch wird die kompliziertere Bedienung des Computers noch komplexer und unübersichtlicher.Das Optacon, welches auch zu den Ausgabegeräten gezählt wird, erscheint in der voranstehenden Übersicht nicht, da es eine sehr umfangreiche Lern- und Trainingsphase voraussetzt, so daß es nicht sehr häufig gebraucht wird. Die genannte Problematik würde hier jedoch genauso zutreffen.
Man kann nicht sagen, welches Ausgabegerät am besten geeignet ist, sondern muß nach dem individuellen Behinderungsprofil des Anwenders und nach der Software, die benutzt wird, differenzieren.
Zu den Ausgabegeräten bei der Projektarbeit mit dem Internet wird in Kapitel näher eingegangen.
Anpassungen in den EingabegerätenZur Peripherie der Eingabegeräte gehören die Schwarzschrift- und Brailletastatur, die Maus sowie der Scanner.
Die Schwarzschrifttastatur stellt im Allgemeinen keine Probleme für Sehgeschädigte dar. Bereits in der Schule (sowohl bei Sehbehinderten als auch Blinden) erhalten sie Schreibmaschinenunterricht, womit sie diese Tastatur beherrschen. Eine Umstellung auf die PC-Tastatur fällt danach kaum schwer. Schwarzschrifttastaturen können mittels einer Software auf die direkte Eingabe von Braillezeichen umgeschaltet werden. Dabei werden den Punkten 1 bis 6 bzw. 8 Tasten der untersten Reihe der Tastatur zugeordnet (sog. „N-key-roll-over-Tastatur"). Die Brailletastatur hingegen ist speziell angefertigt und ermöglicht nur die Eingabe von Zeichen über eine 6- bzw. 8-Punkt-Braille-Tastatur.
Der Scanner erlaubt es blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen, Schwarzschrift und damit Bücher, Zeitschriften etc. zu lesen. Mit einer Kombination von PC, Scanner, Zeichenerkennungsprogramm sowie blindenspezifischer Peripherie sind die Möglichkeiten heute sehr vielfältig.
Problematisch ist hingegen die Maus, die seit der Einführung der grafisch orientierten Benutzeroberfläche nicht mehr wegzudenken ist. Für den blinden Nutzer ist dieses Eingabegerät überhaupt nicht zu bedienen. Auch die Lösung über die Braillezeile mit einem tastsensiblen Sensor über allen Braillemodulen erlaubt zwar das schnelle Cursor-Routing, jedoch sind Bedienfunktionen wie z.B. das Drag&Drop weiterhin unmöglich. Eine mögliche Veränderung des Maussinnbilds, das einen Wechsel der Mausfunktion signalisiert, kann ebenfalls nicht wahrgenommen werden. Für sehbehinderte Nutzer hingegen ist die Maus in ihrer vollen Funktionalität meist erhalten. Durch einen vergrößerten und farblich variabel zu gestaltenden Mauszeiger kann eine individuelle Einstellung erfolgen. Die Maus wird darüber hinaus auch z.T. zum Bedienen der Vergrößerungssoftware benutzt. Das Wiederfinden der Maus auf dem Tisch erübrigt sich mit dem Einsatz eines Trackballs.
Anpassungen in der Peripherie zum InformationsaustauschIn diesem Bereich gibt es die geringsten blinden- und sehbehindertenspezifischen Anpassungen. Noch 1996 wurde z.B. von Degenhardt von einer zunehmenden Bedeutung des Einsatzes sehgeschädigtengerecht modifizierter PCs in Netzwerken sowie der Erschließung der Datenfernübertragung für blinde und sehbehinderte Nutzer ausgegangen.
Heute stellt sich eine derartige Überlegung kaum mehr. Der Anschluß an Netzwerke ist heute problemlos möglich und stellt z.B. bei der Arbeit im Internet die geringsten Schwierigkeiten dar.
Die in Abbildung gezeigte und beschriebene Konfiguration stellt sicherlich eine Maximallösung dar. In diesem Umfang ist eine Realisierung jedoch auf Grund der hohen Kosten selten möglich und vor allem auch nicht sinnvoll. Es muß daher eine fachgerechte und sinnentsprechende Auswahl der Konfiguration erfolgen.
Arbeiten mit grafischen BenutzeroberflächenGrafische Benutzeroberflächen (GUI = Graphical User Interface) haben sich als Benutzerschnittstelle bei der Computernutzung durchgesetzt. Für den Sehenden ist damit eine fast intuitive Benutzung möglich geworden, da die Arbeit vereinfacht und das nahezu spielerische Erlernen der Programmbedienung ermöglicht wird.
Für Blinde und Sehbehinderte gestaltet sich diese Entwicklung jedoch als äußerst schwierig. War es unter DOS noch möglich, den Bildschirminhalt in Sprache oder Punktschrift leicht zu übersetzen, so ist diese Möglichkeit bei grafischen Oberflächen nicht mehr gegeben. Die aufgetretenen Schwierigkeiten beruhen auf der Speicherung und Darstellung des Bildschirminhaltes: DOS teilt den Bildschirm in ein Raster von 25 Zeilen zu 80 Zeichen ein und speichert dies in einem speziellen Bereich des Arbeitsspeichers. Jedes Rasterfeld enthält ein Textzeichen im ASCII-Code sowie ein Attribut für die Gestaltung (z.B. unterstrichen, kursiv). Die Hilfsmittel für Sehgeschädigte konnten auf diesen Speicher zugreifen und die Informationen für die Ausgabe an den spezifischen Geräten verwerten.
Bei GUI ist der Textmodus so nicht mehr gegeben, alle Informationen werden direkt im Grafikmodus, also in Bildpunkten gerastert, auf dem Bildschirm dargestellt. So besteht jedes grafische Objekt, wozu auch Schriftzeichen gezählt werden, aus mehreren hundert bis tausend einzelnen Bildpunkten unterschiedlicher Farbe. Probleme, die sich hieraus ergeben, hat Göhner 1996 bereits zusammengefaßt. Als Beispiel kann hier genannt werden:
Für Sehbehinderte kann dieser Grafikmodus noch durch Vergrößerungsprogramme sowie einer Darstellung auf einem Großbildmonitor zugänglich gemacht werden. Problematisch hierbei ist der geringe Bildschirmüberblick bei zu großem Vergrößerungsfaktor und die treppenförmige Darstellung runder und diagonal verlaufender Konturen.
Für Blinde und hochgradig Sehbehinderte ist diese Möglichkeit jedoch nicht gegeben, weshalb andere Konzepte entwickelt werden mußten. Zwei Ansätze davon hatten längere Zeit Bestand und sollen hier vorgestellt werden:
Als Fazit aller Bemühungen muß festgehalten werden, daß trotz aller Anpassungen „es sich … nie um ein Arbeiten mit Windows … [im Sinne des Arbeitens von Sehenden] handeln kann, wohl aber um die Erschließung von Zugängen, die blinden Menschen trotz der originalen grafischen Oberfläche ein effektives Operieren mit diesen Programmen ermöglichen."
Die Sehschädigung an sich gibt es nicht, denn die Streubreite, die die Beeinträchtigung ausmachen können, ist zu groß, um alle Sehschädigungen gleich zu behandeln.
Deshalb kann es aber auch nicht den einzig richtigen Arbeitsplatz für alle Sehbehinderten und Blinden geben. Die Sehschädigung führt insbesondere zu Anpassungen in den Ausgabegeräten (Brailledrucker/-zeile, Sprachausgabe und Bild- bzw. Schriftvergrößerung). Anpassungen in den Eingabegeräten sind seltener, da die Sehschädigung nur die Benutzung der Maus einschränkt oder verhindert, ebenfalls gibt es in der Peripherie zum Informationsaustausch kaum nötige Veränderungen.
Alle Anpassungen aufgrund der Sehschädigung müssen dem Behinderungsprofil entsprechend ausgewählt und nach der zu verwendenden Software differenziert werden. Einer fachgerechten Beratung und einer angeleiteten Einlernphase kommt hier eine große Bedeutung zu, da der Umgang mit der zusätzlichen Steuerungsfunktion der Hilfsmittel erlernt werden muß. Damit wird leider die komplizierte Bedienung des PC für Sehgeschädigte noch komplexer und unübersichtlicher.
Insgesamt läßt sich feststellen, daß sich vor allem die Arbeit mit den immer öfter anzutreffenden grafischen Benutzeroberflächen für Blinde und Sehbehinderte schwierig gestaltet. Ursprünglich eingeführt, um eine intuitive Benutzerführung zu ermöglichen, hat sich diese Intention bei Sehgeschädigten eher ins Gegenteil verkehrt. Mit der Off-Screen-Methode hat sich ein Konzept durchgesetzt, das auf die rechnerinterne zeichenorientierte Speicherung der Daten zurückgreift. Dennoch tun sich viele Hilfsmittelhersteller schwer damit, ihre entwickelten Hilfsmittel unter grafischen Oberflächen reibungslos zum Arbeiten zu bekommen. Damit ist abzusehen, daß auch das Arbeiten mit grafisch-orientierten Browsern erschwert funktionieren wird.
Computerarbeitsplätze in deutschen Blinden- und SehbehindertenschulenDa der Computer eine wichtige Rolle in vielen Lebensbereichen für Sehgeschädigte sowohl als Werkzeug als auch insbesondere als Hilfsmittel spielt, stellt sich die Frage, inwieweit bereits in der Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte die Schüler auf den Einsatz von Computern vorbereitet werden. Daher soll in den nächsten zwei Kapiteln die Ausstattung dieser Schulen mit Computerarbeitsplätzen aufgezeigt sowie die Inhalte der informationstechnischen Grundbildung dargestellt werden.
Die hier vorgestellten Daten basieren auf einer Umfrage von Degenhardt, der 1994 innerhalb eines Projektes am Institut für Behindertenpädagogik der Universität Hamburg insgesamt ca. 50 deutsche Blinden- und Sehbehindertenschulen angeschrieben hat, um deren Ausstattungssituation zu erheben, wovon 30 Einrichtungen geantwortet haben. Diese Ergebnisse wurden 1997 von Stäger-Riebke an den fünf Schulen für Blinde und Sehbehinderte in Baden-Württemberg erneuert.
Insgesamt läßt sich mit den Ergebnissen der Umfrage festhalten, daß keine falschen Vorstellungen und Illusionen über den Umfang des Computereinsatzes entstehen dürfen, denn es handelt sich lediglich um geringe Zahlen. Hinzu kommt, daß der „Ausstattungsgrad [dieser] … Schulen weit hinter den medien- und sehgeschädigtenpädagogisch möglichen und anstrebenswerten Potenzen und Chancen des Computereinsatzes zurücksteht."
Zum Sommer 1994 sind an den erfaßten 30 Einrichtungen insgesamt 256 PC-Arbeitsplätze vorhanden (s. Abb. 3.4). Die Spannbreite reicht dabei von 2 PC-Plätzen bis sogar 35 Plätzen, wobei im Mittel (Median) 6 PC-Plätze je Schule vorkommen.
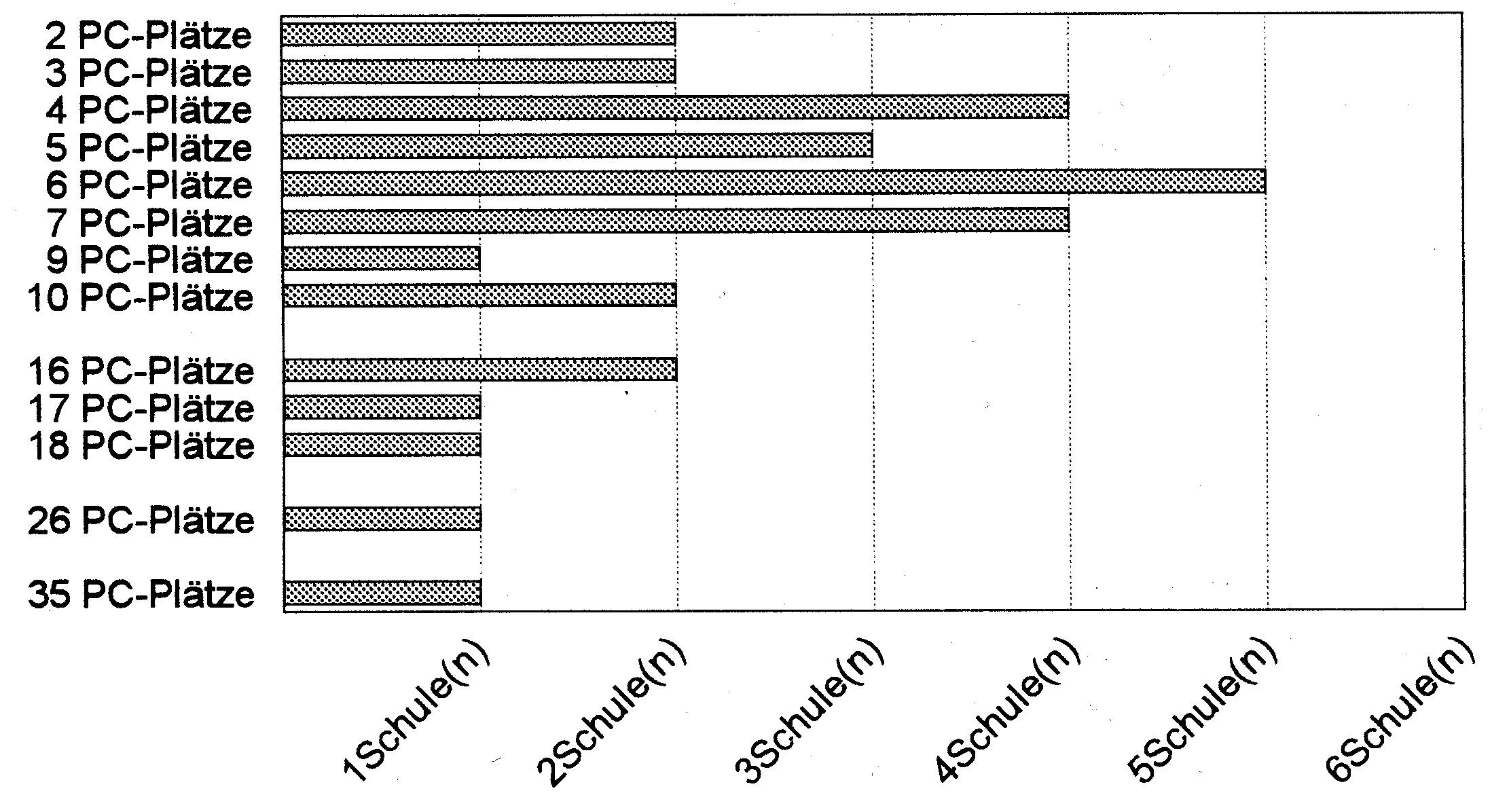
(Anzahl der PC-Arbeitsplätze 1997 in Baden-Württemberg: je eine Schule mit 14, 22, 24, 60 sowie 90 Computerarbeitsplätzen, die den Schülern zugänglich sind)
Es ist bemerkenswert, daß lediglich an 6 Einrichtungen zumindest ein Teil der vorhandenen PCs miteinander vernetzt sind (Novell oder IBM-LAN). Bei 80% der Einrichtungen steht dem großen finanziellen, organisatorischen und Schulungsaufwand noch nicht genug Nutzen gegenüber.
(Vernetzung 1997 in Baden-Württemberg: 3 Schulen sind teilweise vernetzt, eine Schule komplett; Internet-Zugang besteht nur an zwei Schulen)
In Kapitel Anpassungen in den Ausgabegeräten wurden verschiedene sehgeschädigtenspezifische Konfigurationen vorgestellt. Überträgt man diese Einteilung auf die Ausstattung an den untersuchten Sonderschulen, ergibt sich folgendes Bild:
Bei dieser Aufschlüsselung zeigt sich deutlich die doch sehr unterschiedliche Ausstattung der PC-Plätze an den Schulen. Am ehesten sind an den Arbeitsplätzen Großbildmonitore sowie Großschriftsysteme zu finden.
(Anpassungen der Ausgabegeräte 1997 in Baden-Württemberg: 4 Schulen mit Braillezeile, 2 Schulen mit Brailledrucker, alle 5 Schulen mit 20- oder 21-Zoll-Bildschirmen, nur eine Schule mit Sprachausgabesystem)
Bei der Verteilung auf die Räume zeigt sich ebenfalls ein sehr interessantes Bild. Lediglich in 7 Einrichtungen sind 1 bis 4 Klassenräume mit jeweils 1 bis 8 PCs ausgerüstet. In der Mehrzahl steht der Computer jedoch in separaten PC-Räumen mit 1 bis 13 PCs, weshalb sich die Nutzung auch deutlich auf den Unterricht (Informatik, Mathematik) sowie auf Arbeitsgemeinschaften bei den Schülern sowie zur Medienerstellung bei den Lehrern beschränkt, man ist zu Gast im PC-Raum (s. Abb. 3.5: Nutzung der PC-Arbeitsplätze). Verläßt man den Raum wieder, beendet man auch die Arbeit am PC. Daher spielt ein breiter Einsatz des Computers derzeit noch eine untergeordnete Rolle im Fachunterricht. Leider ist damit auch die Möglichkeit eines schnellen und unkomplizierten Einsatzes des Internet im Unterricht nicht möglich, eine schnelle Recherche zu einem anstehenden Problem ist nicht realisierbar.
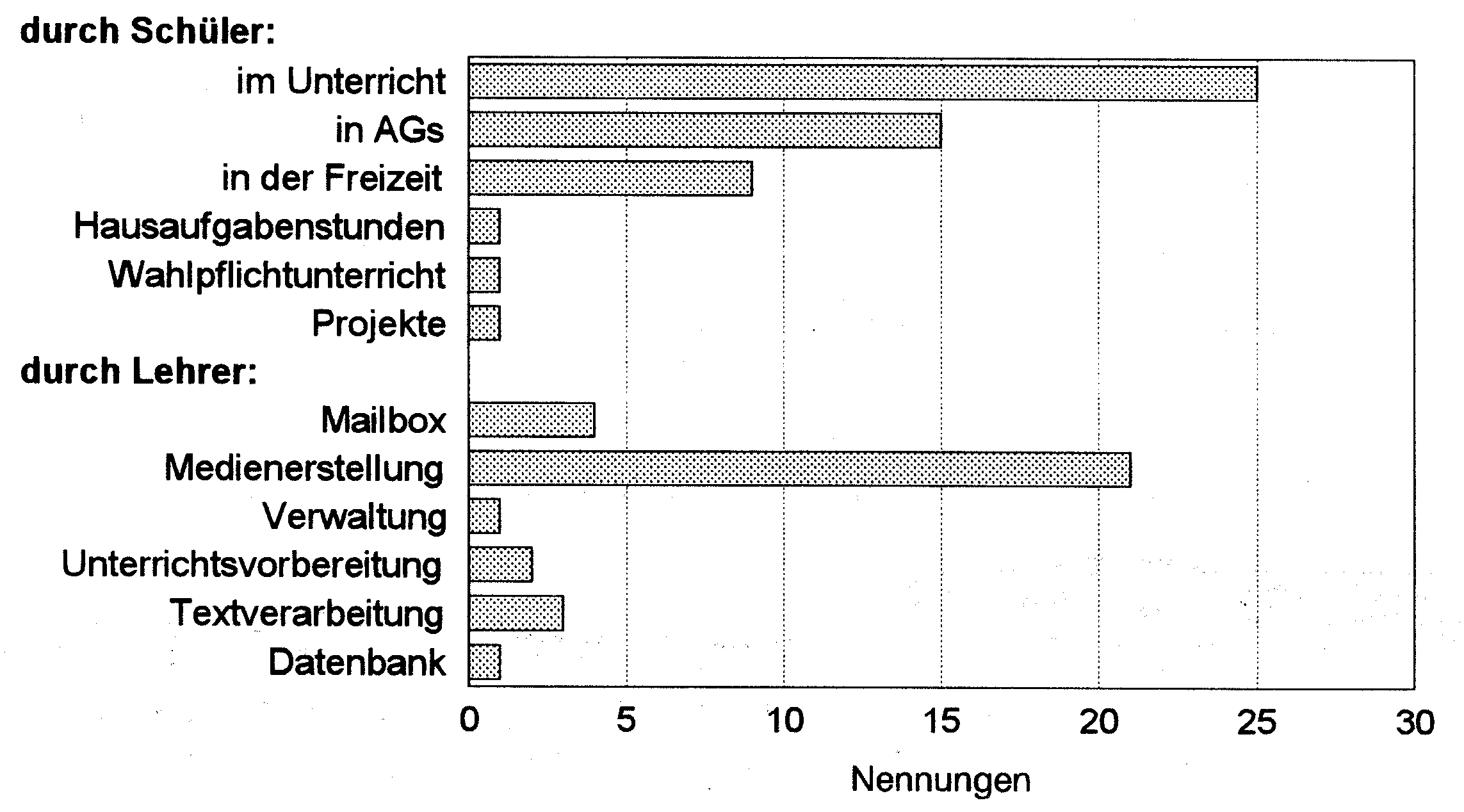
(Nutzung der Arbeitsplätze 1997 in Baden-Württemberg: an 4 der 5 Schulen sind spezielle Computerräume eingerichtet, die Computer werden v.a. im Fach Maschinenschreiben bzw. Informatik genutzt, teilweise aber auch in Arbeitsgemeinschaften und Projekten.)
Da sich die Arbeit im Internet für Sehgeschädigte mit ihren Peripheriegeräten als kompliziert und fehleranfällig herausgestellt hat, ist in diesem Bezug die Möglichkeit einer Hilfestellung durch einen EDV-Koordinator interessant. Wie Abb. EDV-Koordinatoren an den Schulen zeigt, ist die Situation sehr unterschiedlich. So gibt es sogar fünf Schulen, die keine EDV-Koordinator haben, eine Schule hat hingegen drei Fachleute.
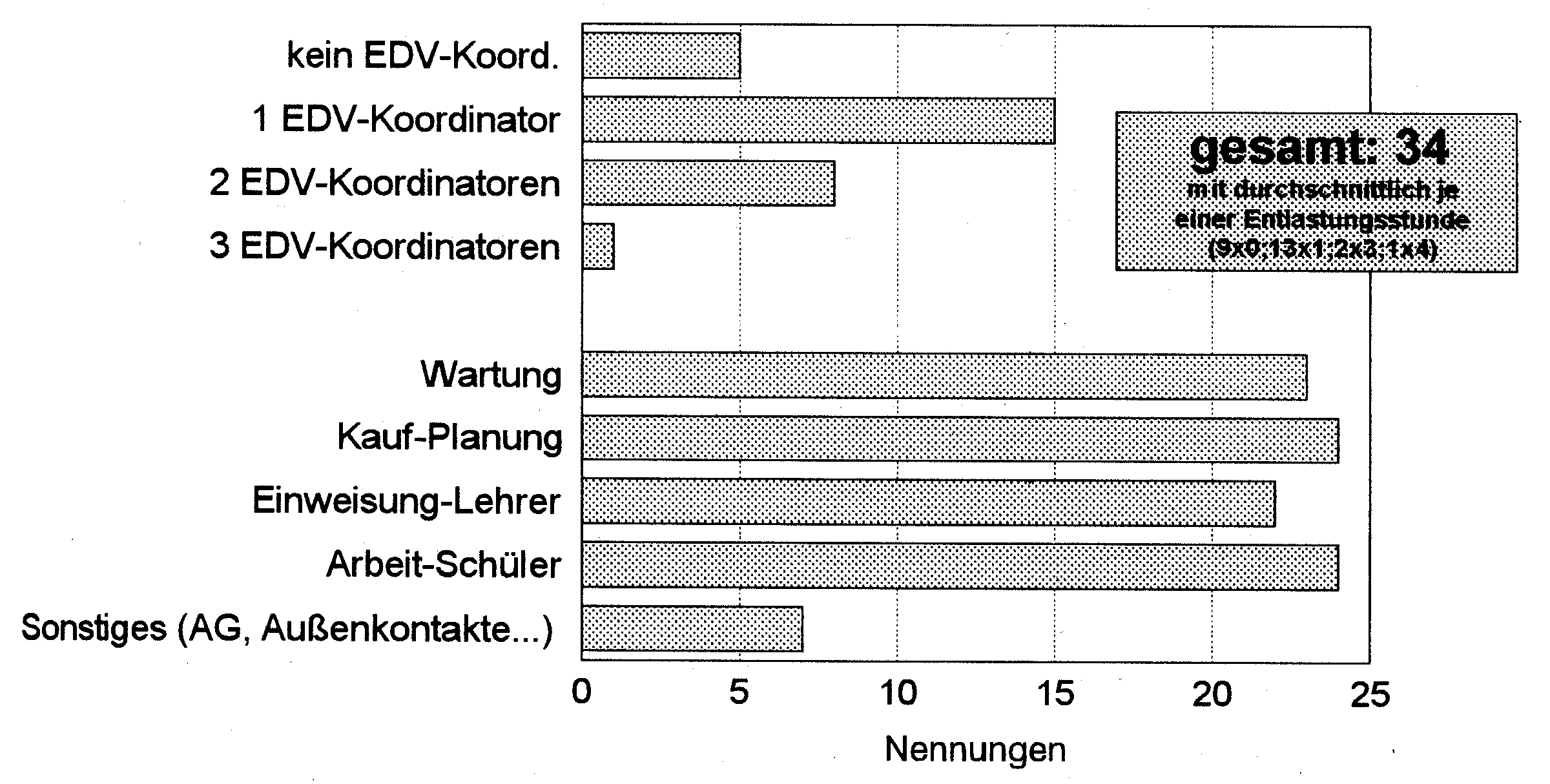
(EDV-Koordinatoren 1997 in Baden-Württemberg: 3 Schulen mit je einem EDV-Koordinator, eine Schule mit 2 Verantwortlichen und an einer Schule arbeitet ein Team)
In der Zukunft, in der die Software weitere umfangreiche Features aufzeigt, die Geräte selber noch leistungsstärker werden, stellt sich jedoch die Frage, ob die Schulen nicht auf jeden Fall einen PC-Verantwortlichen mit angemessenem Zeitbudget benötigen, um die gesamten Anforderungen noch zu erfüllen. Denn ein PC-Raum ohne Betreuung wird in kürzester Zeit nicht genutzt werden, da die Geräte nicht fehlerfrei funktionieren und bei anstehenden Problemen niemand gefragt werden kann.
Informationstechnische GrundbildungMit Beginn der 80er Jahre begann das Bildungssystem mit Überlegungen, wann und wie die Schule auf die gesellschaftlichen Veränderungen in den Informations- und Kommunikationstechniken reagieren soll. Im Verlauf dieser Diskussionen kam es zu zwei Veröffentlichungen, die die Rahmenbedingungen einer informationstechnischen Grundbildung legten:
Die Struktur der informationstechnischen Bildung in Allgemeinbildenden Schulen wird in der Abbildung dargestellt.
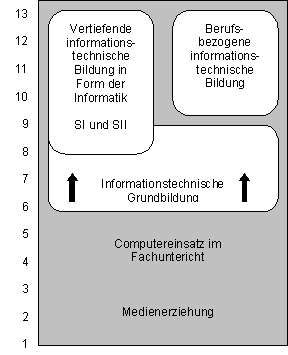
1987 wurde im Rahmen einer bildungspolitischen Forderung die Einführung einer informationstechnischen Grundbildung für alle empfohlen, auf die spezielle Angebote aufbauen.
Die Ziele und Inhalte der informationstechnischen Grundbildung werden im Rahmen der BLK-Empfehlung wie folgt umrissen:
Bezieht man diese Inhalte und Ziele, die für alle Schularten gelten sollen, auf die Sonderschulen für Blinde und Sehbehinderte, so zeigt sich, daß leider ein wichtiger Aspekt nicht aufgenommen wurde, der jedoch gerade für Sehgeschädigte von besonderer Bedeutung sein könnte: „Die gezielte Förderung einer Nutzung dieser neuen Techniken als Hilfsmittel in schulischen und außerschulischen Zusammenhängen." Dieser Aspekt darf jedoch in einer Schule, die auf das Leben vorbereiten will, nicht unberücksichtigt bleiben.
In diesem Zusammenhang kommt nun auch der Behandlung des Internet für sehgeschädigte Schüler ein wichtige Bedeutung zu. Mit der wachsenden Verbreitung des Internet werden über dieses Medium immer mehr Informationen verbreitet. Sollen jedoch Sehgeschädigte in diesem Bereich nicht ausgeschlossen werden, so gilt es bereits in der Schule die Jugendlichen darauf vorzubereiten (Ziel: Vermittlung von Kenntnissen, Schaffung des Bewußtseins für die Auswirkungen).
Gerade an diesem Medium spiegelt sich auch die Begründungslogik wider, mit der seit der Einführung der informationstechnischen Grundbildung der Computereinsatz in Sonderschulen diskutiert wird: Zum einem kommt aufgrund der zunehmenden Verbreitung der Computertechnik im Berufsleben und in der Freizeit der Schule die Aufgabe zu, sich dem Druck von außen zu beugen und auch die behinderten Schüler mit den Informations- und Kommunikationstechniken vertraut zu machen. Andererseits dient der Computer gerade in diesem Bereich des Internet als „Brücke nach außen", da neue Kommunikationswege erschlossen werden.
Als sinnvoll erscheint es, beide Begründungsstrategien gleichberechtigt im Verbund zu verwenden, da hierbei die größten Erfolge für die Schüler erzielt werden können.
![]()
![]() Internet: Ein Medium der Zukunft
Internet: Ein Medium der Zukunft
![]() Gesellschftsplitische Bedeutung für Sehgeschädigte und neue Perspektiven
Gesellschftsplitische Bedeutung für Sehgeschädigte und neue Perspektiven
![]()